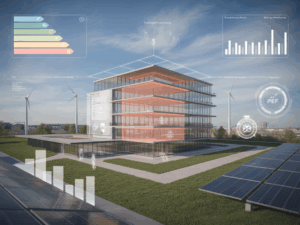Primärenergiefaktor einfach erklärt
Der Primärenergiefaktor (PEF) ist eine zentrale Kennzahl der energetischen Gebäudebewertung. Er zeigt, wie viel Energie insgesamt aufgewendet werden muss, um Nutzenergie – also Wärme, Strom oder Kälte – bereitzustellen. Dabei berücksichtigt der PEF nicht nur den direkten Verbrauch im Gebäude, sondern auch vorgelagerte Prozesse wie Förderung, Umwandlung, Speicherung und Transport der Energieträger. So lässt sich der tatsächliche Gesamtenergiebedarf – der Jahresprimärenergiebedarf – eines Gebäudes realistisch bestimmen.
Das Wichtigste in Kürze
Inhaltsverzeichnis
- Das Wichtigste in Kürze
- Was ist der Primärenergiefaktor?
- Definition und Bedeutung des Primärenergiefaktors
- Primärenergiefaktoren nach GEG im Überblick
- Berechnung und Grundlage des Primärenergiefaktors
- Erneuerbare und nicht-erneuerbare Energieträger im Vergleich
- Besonderheiten des Primärenergiefaktors bei Strom, KWK und Wärmepumpen
- Rolle des Primärenergiefaktors im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und der BEG-Förderung
- Fazit
- FAQ
- Was ist der Primärenergiefaktor (fp)?
- Wofür wird der Primärenergiefaktor benötigt?
- Wie wird der Primärenergiefaktor berechnet?
- Was sagt ein hoher Primärenergiefaktor aus?
- Was bedeutet ein niedriger Primärenergiefaktor?
- Was ist der Unterschied zwischen fp,ges und fp,ne?
- Welche Faktoren gelten für Strom aus dem öffentlichen Netz?
- Haben erneuerbare Energien immer einen Primärenergiefaktor von 0?
- Wer legt die Primärenergiefaktoren fest?
- Welche Rolle spielt der Faktor bei Nah- und Fernwärme?
- Der Primärenergiefaktor (PEF) vergleicht die Energieeffizienz verschiedener Energieträger objektiv.
- Er bezieht alle vorgelagerten Prozesse wie Förderung, Aufbereitung, Transport und Umwandlung mit ein.
- Die Berechnungsgrundlage liefert die DIN V 18599 in Verbindung mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG).
- Für erneuerbare Energien beträgt der PEF in der Regel 1,0, für netzbezogenen Strom derzeit 1,8.
- Der PEF beeinflusst Förderprogramme und gesetzliche Effizienzstandards maßgeblich.
Was ist der Primärenergiefaktor?
Der Primärenergiefaktor (PEF) gibt an, wie viel Energie aufgewendet werden muss, um eine bestimmte Menge Endenergie bereitzustellen. Er berücksichtigt alle Energieverluste in vorgelagerten Prozessen wie Gewinnung, Transport und Umwandlung und dient der Vergleichbarkeit verschiedener Energieträger nach ihrer Energieeffizienz.
Definition und Bedeutung des Primärenergiefaktors
Der Primärenergiefaktor wurde 2002 mit der Energieeinsparverordnung (EnEV) eingeführt, die heute im Gebäudeenergiegesetz (GEG) aufgegangen ist. Ziel war es, den Energiebedarf von Gebäuden nicht nur anhand der Endenergie, sondern anhand des gesamten Energieaufwands zu bewerten. Der PEF zeigt, wie viel Primärenergie nötig ist, um eine bestimmte Endenergiemenge zu liefern. Laut dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages beschreibt der Faktor den Gesamtaufwand von Förderung, Aufbereitung, Transport und Verteilung eines Energieträgers. Es handelt sich dabei nicht um einen Wirkungsgrad, sondern um eine Bewertungsgröße, die Transparenz über die energetische Effizienz verschiedener Systeme schafft.
Für die Gebäudebilanzierung gilt die Formel:
Jahresprimärenergiebedarf QP = Endenergiebedarf (QE) × Nicht-erneuerbarer Anteil des PEF (fP).
Damit lässt sich die energetische Qualität eines Gebäudes bestimmen und gesetzliche Anforderungen nach § 22 GEG prüfen.
Primärenergiefaktoren nach GEG im Überblick
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) regelt in Anlage 4 die Primärenergiefaktoren für verschiedene Energieträger. Diese Werte sind entscheidend, um Gebäude energetisch zu bewerten und Förderfähigkeit zu prüfen. Die folgende Tabelle zeigt die aktuell gültigen PEF-Werte für nicht-erneuerbare Anteile:
| Kategorie | Energieträger | Primärenergiefaktor (nicht erneuerbar) |
|---|---|---|
| Fossile Brennstoffe | Heizöl | 1,1 |
| Fossile Brennstoffe | Erdgas | 1,1 |
| Fossile Brennstoffe | Flüssiggas | 1,1 |
| Fossile Brennstoffe | Steinkohle | 1,1 |
| Fossile Brennstoffe | Braunkohle | 1,2 |
| Biogene Brennstoffe | Biogas | 1,1 |
| Biogene Brennstoffe | Bioöl | 1,1 |
| Biogene Brennstoffe | Holz | 0,2 |
| Strom | Netzbezogen | 1,8 |
| Strom | Gebäudenah erzeugt (PV/Wind) | 0,0 |
| Strom | Verdrängungsstrommix für KWK | 2,8 |
| Wärme/Kälte | Geothermie, Solarthermie, Umgebungswärme | 0,0 |
| Wärme/Kälte | Abwärme | 0,0 |
| Wärme/Kälte | Wärme aus KWK (gebäudeintegriert) | nach DIN V 18599 |
| Siedlungsabfälle | – | 0,0 |
Diese Faktoren werden regelmäßig überprüft und angepasst, um technologische Entwicklungen und Veränderungen im Energiemix abzubilden.
Berechnung und Grundlage des Primärenergiefaktors
Die Berechnung des PEF erfolgt auf Basis der DIN V 18599, die alle vorgelagerten Prozessketten eines Energieträgers erfasst. Dabei werden sowohl erneuerbare als auch nicht-erneuerbare Energieanteile berücksichtigt. Der Gesamt-PEF ergibt sich aus der Summe beider Teilfaktoren. Grundlage dieser Berechnung ist das Modell GEMIS (Globales Emissions-Modell integrierter Systeme), das in über 30 Ländern für Umwelt- und Energieanalysen genutzt wird.
Ein Beispiel: Für Heizöl oder Erdgas liegt der PEF bei 1,1, da Förder-, Aufbereitungs- und Transportprozesse Energie benötigen. Bei Strom aus dem Netz werden Wirkungsgrade der Kraftwerke und Netzverluste mit einbezogen, weshalb sein PEF mit 1,8 höher ausfällt. Holz hingegen gilt als nahezu klimaneutraler Brennstoff, da es einen erneuerbaren Anteil von 1,0 und einen nicht-erneuerbaren Anteil von 0,2 hat.
Diese Differenzierung sorgt dafür, dass die Bewertung von Gebäuden fairer und ökologisch realistischer wird.
Erneuerbare und nicht-erneuerbare Energieträger im Vergleich
Erneuerbare Energieträger wie Solarenergie, Geothermie oder Umgebungswärme besitzen einen PEF von 1,0. Das bedeutet, dass die gewonnene Energie vollständig aus regenerativen Quellen stammt. Der nicht-erneuerbare Anteil beträgt null, da keine fossilen Ressourcen benötigt werden.
Bei nicht-erneuerbaren Energieträgern wie Erdgas, Heizöl oder Kohle sieht das anders aus. Hier muss die gesamte Förder- und Aufbereitungsenergie berücksichtigt werden. Diese Energieträger haben deshalb PEF-Werte über eins.
Ein praktisches Beispiel verdeutlicht den Unterschied: Wird 100 Einheiten Endenergie aus Holz gewonnen, liegt der Primärenergiebedarf aufgrund des PEF von 1,2 bei 120. Bei netzbezogenem Strom mit einem PEF von 1,8 beträgt der Primärenergiebedarf sogar 180. Diese Berechnungen machen deutlich, dass erneuerbare Energiequellen energetisch und ökologisch vorteilhafter sind.
Besonderheiten des Primärenergiefaktors bei Strom, KWK und Wärmepumpen
Der PEF für Strom verändert sich dynamisch durch den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien im Netz. Laut dem IINAS-Institut Darmstadt lag der PEF für Strom 2020 bereits bei 1,3 – deutlich niedriger als der GEG-Wert von 1,8.
Für KWK-Strom (Kraft-Wärme-Kopplung) wird ein höherer PEF von 2,8 angesetzt, da sogenannter „Verdrängungsstrom“ oft aus fossilen Mittellastkraftwerken stammt. Diese Bewertung berücksichtigt, dass KWK-Strom nicht direkt den grünen Strommix verdrängt, sondern konventionelle Kraftwerke beeinflusst.
Wärmepumpen wiederum profitieren vom kombinierten Einsatz von Umweltwärme und Strom. Ihre Effizienz wird über die Jahresarbeitszahl (JAZ) beschrieben. Liegt diese über 1,63, arbeitet die Wärmepumpe energetisch günstiger als Öl- oder Gasheizungen. Wird sie mit Solarstrom betrieben, fällt der PEF sogar auf null – es muss keine zusätzliche Primärenergie aufgewendet werden.
Rolle des Primärenergiefaktors im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und der BEG-Förderung
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), in Kraft seit November 2020, fasst EnEV, EnEG und EEWärmeG zusammen und definiert die energetischen Standards für Gebäude. Es legt in § 22 fest, wie der Primärenergiefaktor anzuwenden ist, und bestimmt in Anlage 4 die verbindlichen Werte für alle Energieträger. Der Jahresprimärenergiebedarf gilt als zentrales Kriterium für Neubauten (§ 15 GEG) und Bestandsgebäude (§ 50 GEG).
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) nutzt den PEF ebenfalls als Bewertungsgröße. Hier ersetzt die jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz (ηS) die frühere Jahresarbeitszahl (JAZ) als Effizienzmaß. Für die Berechnung wird der PEF der Antriebsenergie herangezogen. So zeigt ηS, wie viel Primärenergie für eine erzeugte Kilowattstunde Wärme benötigt wird.
Die BEG schreibt für Wärmepumpen folgende Werte vor:
| Wärmepumpen-Typ | ηS bei 35 °C | ηS bei 55 °C |
|---|---|---|
| Luft/Wasser-Wärmepumpe | 135 % | 120 % |
| Sole/Wasser-Wärmepumpe | 150 % | 135 % |
| Wasser/Wasser-Wärmepumpe | 150 % | 135 % |
Durch diese Definitionen wird der PEF zu einem zentralen Kriterium sowohl für Effizienzbewertung als auch Förderfähigkeit moderner Heizsysteme.
Fazit
Der Primärenergiefaktor ist weit mehr als eine Zahl: Er ist ein Maßstab für Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Zukunftsfähigkeit. Er zeigt, wie ressourcenschonend ein Gebäude tatsächlich betrieben wird und beeinflusst Förderungen, gesetzliche Standards und die Energiewende direkt. Je niedriger der PEF, desto klimafreundlicher das System – und desto näher rückt das Ziel einer vollständig dekarbonisierten Energieversorgung.
Quellen zum Thema Primärenergiefaktor:
- Primärenergiefaktor – Wikipedia
- Primärenergiefaktor | Dämmstoffe | Glossar – BauNetz Wissen
- Anlage 4 (zu § 22 Absatz 1) Primärenergiefaktoren – Gebäudeenergiegesetz (GEG)
FAQ
Was ist der Primärenergiefaktor ()?
Der Primärenergiefaktor ist eine Kennzahl, die das Verhältnis zwischen der eingesetzten Primärenergie und der am Gebäude bereitgestellten Endenergie für einen Energieträger oder ein Nah-/Fernwärmenetz beschreibt. Er bewertet die Gesamtenergieeffizienz von der Energiegewinnung bis zur Nutzung.
Wofür wird der Primärenergiefaktor benötigt?
Er wird im Rahmen des deutschen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) verwendet, um den Jahres-Primärenergiebedarf eines Gebäudes zu berechnen und somit die Einhaltung der gesetzlichen Energieeffizienzanforderungen nachzuweisen. Die Kennzahl dient als Maßstab für die ökologische Bewertung verschiedener Energieträger.
Wie wird der Primärenergiefaktor berechnet?
Er berechnet sich aus der Summe der nicht erneuerbaren und der erneuerbaren Primärenergie, die für die Bereitstellung einer Einheit Endenergie notwendig sind. Der Faktor berücksichtigt Verluste bei der Förderung, Umwandlung, Verteilung und Speicherung des Energieträgers.
Was sagt ein hoher Primärenergiefaktor aus?
Ein hoher Primärenergiefaktor deutet auf einen relativ ineffizienten oder ökologisch nachteiligen Energieträger hin, da viel Primärenergie für die Bereitstellung der Endenergie verloren geht. Dies ist oft bei fossilen Brennstoffen oder ineffizienten Erzeugungsanlagen der Fall.
Was bedeutet ein niedriger Primärenergiefaktor?
Ein niedriger Wert signalisiert einen hohen ökologischen Vorteil und eine hohe Effizienz des Energieträgers, da zur Bereitstellung der Endenergie wenig Primärenergie benötigt wird. Energieträger mit hohem Anteil an erneuerbaren Energien (wie Fernwärme mit Biomasse-Anteil) haben typischerweise niedrige Faktoren.
Was ist der Unterschied zwischen und ?
(gesamt) beinhaltet die gesamte Primärenergie (erneuerbar und nicht erneuerbar), während nur den Anteil der nicht erneuerbaren Primärenergie berücksichtigt. Für den Primärenergiebedarf nach GEG ist meist der nicht erneuerbare Anteil () ausschlaggebend.
Welche Faktoren gelten für Strom aus dem öffentlichen Netz?
Der Primärenergiefaktor für allgemeinen Netzstrom in Deutschland ist in der Regel auf 1,8 (nicht erneuerbar) festgelegt, was die durchschnittliche Ineffizienz bei der Stromerzeugung aus dem aktuellen Strommix widerspiegelt. Ökostrom kann durch einen geringeren oder sogar negativen Faktor besser bewertet werden, sofern dies nach GEG-Regeln nachgewiesen wird.
Haben erneuerbare Energien immer einen Primärenergiefaktor von 0?
Nein, für regenerativ erzeugte Energieträger wie Holzpellets oder Biogas wird der Faktor (nicht erneuerbar) oft Null gesetzt, weil die Energiequelle als CO2-neutral gilt. Jedoch ist der (gesamt) nicht immer Null, da Hilfsenergien (z.B. für Transport oder Aufbereitung) berücksichtigt werden müssen.
Wer legt die Primärenergiefaktoren fest?
In Deutschland werden die Standardwerte für die gängigsten Energieträger (wie Erdgas oder Heizöl) durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und seine Verordnungen festgesetzt und regelmäßig aktualisiert. Für Fernwärmenetze muss der individuelle Faktor vom Netzbetreiber nach einem genormten Verfahren berechnet und jährlich ausgewiesen werden.
Welche Rolle spielt der Faktor bei Nah- und Fernwärme?
Nah- und Fernwärme können sehr niedrige, netzspezifische Faktoren aufweisen, insbesondere wenn sie einen hohen Anteil aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) oder erneuerbaren Energien (z.B. Biomasse, Geothermie) nutzen. Ein niedriger Faktor kann die Erfüllung der GEG-Anforderungen für ein Gebäude erheblich erleichtern.